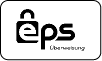Produktinformationen "Adenocarcinoma of the stomach"
Klinische Vorgeschichte
Eine 82-jährige Frau stellte sich mit Melaena vor und berichtete über sechs Monate Dyspepsie, Übelkeit, Gewichtsverlust und frühe Sättigung. Kurz nach Aufnahme erlitt sie eine massive Blutung und verstarb.
Pathologie
Ein Sarkitalschnitt (Speiseröhre, Magen, Duodenum sowie Pankreas) zeigt ein oberflächliches Ulkus (7×5?cm) an der kleinen Kurvatur mit erhöhtem, aufgerolltem Rand und nekrotischen Ablagerungen. Eine helle Tumorzone hebt den Rand. Zwei erodierte Arterien und frische Blutung sind sichtbar, das Pankreas haftet an der serösen Oberfläche des Ulkus. Die Histologie bestätigte ein gut differenziertes Adenokarzinom des Magens mit Invasion des Pankreas.
Weitere Informationen
Das Magen-Adenokarzinom ist der häufigste Magenkrebs mit regional sehr unterschiedlichen Raten. Risikofaktoren sind Rauchen, salzreiche Ernährung, H. pylori, Reflux, atrophe Gastritis und intestinale Metaplasie. Es gibt zwei Hauptformen:
- Intestinaler Typ: Drüsenartig, oft große Läsionen, üblicherweise bei Männern um 55?Jahre, oft mit Dysplasie oder Adenomen als Vorstufe.
- Diffuser Typ: Signet-Ring-Zellen, infiltrierend, führt zur Verdickung der Magenwand („leather bottle“-Stadium), ohne Geschlechts- oder Regionsunterschied. Vermehrt bei CDH1-Mutationen und bei Patienten mit FAP und APC-Mutation.
Frühsymptome: Dyspepsie, Dysphagie, Übelkeit. Spätsymptome: Gewichtsverlust, frühe Sättigung, Müdigkeit, Anämie oder Blutungen. Behandlung richtet sich nach Stadium: OP bei frühen Tumoren, Chemotherapie bei fortgeschrittenen.
Eine 82-jährige Frau stellte sich mit Melaena vor und berichtete über sechs Monate Dyspepsie, Übelkeit, Gewichtsverlust und frühe Sättigung. Kurz nach Aufnahme erlitt sie eine massive Blutung und verstarb.
Pathologie
Ein Sarkitalschnitt (Speiseröhre, Magen, Duodenum sowie Pankreas) zeigt ein oberflächliches Ulkus (7×5?cm) an der kleinen Kurvatur mit erhöhtem, aufgerolltem Rand und nekrotischen Ablagerungen. Eine helle Tumorzone hebt den Rand. Zwei erodierte Arterien und frische Blutung sind sichtbar, das Pankreas haftet an der serösen Oberfläche des Ulkus. Die Histologie bestätigte ein gut differenziertes Adenokarzinom des Magens mit Invasion des Pankreas.
Weitere Informationen
Das Magen-Adenokarzinom ist der häufigste Magenkrebs mit regional sehr unterschiedlichen Raten. Risikofaktoren sind Rauchen, salzreiche Ernährung, H. pylori, Reflux, atrophe Gastritis und intestinale Metaplasie. Es gibt zwei Hauptformen:
- Intestinaler Typ: Drüsenartig, oft große Läsionen, üblicherweise bei Männern um 55?Jahre, oft mit Dysplasie oder Adenomen als Vorstufe.
- Diffuser Typ: Signet-Ring-Zellen, infiltrierend, führt zur Verdickung der Magenwand („leather bottle“-Stadium), ohne Geschlechts- oder Regionsunterschied. Vermehrt bei CDH1-Mutationen und bei Patienten mit FAP und APC-Mutation.
Frühsymptome: Dyspepsie, Dysphagie, Übelkeit. Spätsymptome: Gewichtsverlust, frühe Sättigung, Müdigkeit, Anämie oder Blutungen. Behandlung richtet sich nach Stadium: OP bei frühen Tumoren, Chemotherapie bei fortgeschrittenen.
🔬 3D-Anatomie-Reihe – Nachbildungen des menschlichen Körpers!
26. August 2025
Entdecken Sie exklusive 3D-gedruckte Modelle des menschlichen Körpers – aus echten Präparaten erstellt.
Erler-Zimmer
Erler-Zimmer GmbH & Co.KG
Hauptstrasse 27
77886 Lauf
Germany
info@erler-zimmer.de
Achtung! Medizinisches Ausbildungsmaterial, kein Spielzeug. Nicht geeignet für Personen unter 14 Jahren.
Attention! Medical training material, not a toy. Not suitable for persons under 14 years of age.